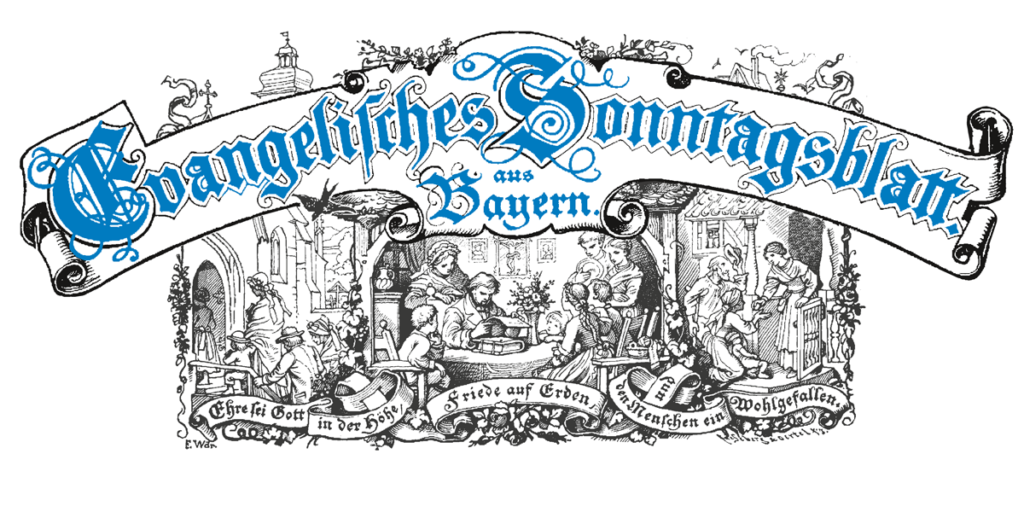Editorial im Evangelischen Sonntagsblatt aus Bayern von Inge Wollschläger
Ganz schmal liegt sie im Krankenhausbett. Die Bäckchen der 88-jährigen sind ein wenig errötet – was vielleicht am farbenfrohen Nachthemd liegen mag. Ich habe ihr das Kissen aufgeschüttelt. Nun wirkt es so, als habe sie es sehr bequem und behaglich. Die Blumen, die ich ihr mitgebracht habe, schiebe ich in ihr Sichtfeld. „Oh! Blumen!“, freut sie sich und erzählt von der Großmutter, die immer „die schönsten Blumen weit und breit ihn ihrem Garten hatte“.
Seit ein paar Tagen ist sie nun schon im Krankenhaus. Nachts hörten die Nachbarn ihren piepsenden Rauchmelder. Der Schwelbrand auf ihrem Herd in der Küche war zum Glück schnell gelöscht.
Aber das weiß sie alles nicht mehr so recht. „Gebrannt? In meiner Küche? Aber warum denn?“ An den Brand der elterlichen Scheune in ihrer Kindheit im 2. Weltkrieg hat sie deutlichere Erinnerungen.
Wenn alles „nach Plan“ verläuft, zieht sie vom Krankenhaus direkt in ein Pflegeheim. Ihren bisher bekannten Alltag wird es nicht mehr geben. Ihre Demenz ist zu weit fortgeschritten. Da können es die Menschen, die ihr nahe stehen, nicht mehr verantworten, dass sie alleine lebt. Enge Angehörige hat sie nicht, die sich um sie kümmern. „Fremde“ entscheiden jetzt über ihre weitere Zukunft.
„So schöne Blumen“, sagt sie und streichelt eine rosa Hyazinthe, die aus dem Strauß heraussticht. „Wie bei meiner Großmutter im Garten!“
Ich möchte von ihr wissen, was denn nun mit ihren Sachen werden soll. „Ich brauche das alles nicht mehr!“, sagt sie. „Ich habe doch alles!“
Ich weiß nicht, ob diese Worte besonders weise oder die Aussage einer an rasch fortschreitender Demenz Erkrankten sind.
Wenn ich sie so liegen sehe, klingt es wahr. Sie liegt warm und weich. Ein Glas Wasser steht am Bett und Blumen sind auf dem Nachttisch. In einer halben Stunde gibt es Abendbrot.
Schmerzen hat sie nicht. Alles, was sie braucht, hat sie – inklusive Menschen, die sich um sie bemühen, damit sie es weiter bequem und behaglich hat. Es erscheint mir, als würde sie die Welt und ihr Leben mit glasklarem Blick sehen – jenseits von irgendwelchen Diagnosen.“
Ein bisschen erinnert sie mich an die „Lilie auf dem Felde“. Eine sehr zufriedene Lilie, die sich nicht kümmern muss, die alles hat, was sie zum Leben braucht und für die gut gesorgt wird.