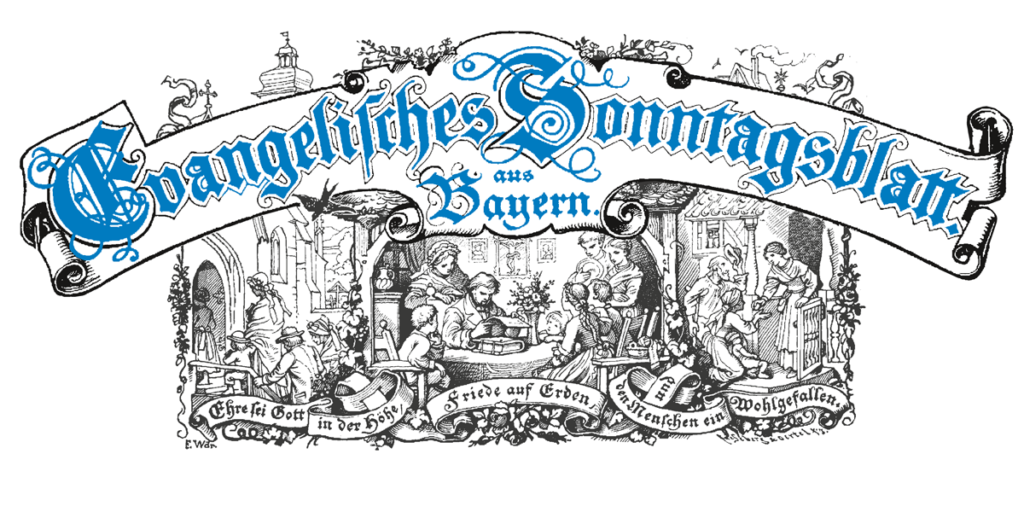„Jesus von Nazareth zwischen Judentum und Christentum“ – eine unmögliche Position?
Ist es nicht ein unmöglicher Spagat, den Christian Danz versucht? Wie kann „Jesus von Nazareth zwischen Judentum und Christentum“ verstehbar sein? Der Wiener evangelische Theologe, der ursprünglich aus Thüringen stammt, versucht in seinem 2020 erschienenen Werk unter diesem Titel nicht nur eine Neudeutung des Verhältnisses zwischen den beiden Geschwister-Religionen. Nein, er wendet sich damit grundlegenden Fragen der Christologie zu.
Schließlich erhob das Christentum bereits in der Antike den Anspruch, das wahre Israel zu sein. Die alttestamentarischen Verheißungen hätten sich in Jesus Christus verwirklicht und in der universalen Kirche anstelle des Gottesbundes mit Israel.
Eine solche Verzahnung der beiden Testamente war nach dem Holocaust mehr als fraglich. Trug nicht dieser christliche Ansatz zur Abwertung des Judentums bei? Und hatte er nicht dadurch eine Mitschuld an dieser unermesslichen Katastrophe?
Aus diesem Bewusstsein heraus geschah eine Umkehr: „Jesus Christus überwindet nun nicht mehr das Judentum, er, so die neue Deutung, wiederholt dieses oder bestätigt den Bund Gottes mit Israel und die ihm geltenden Verheißungen“, so fasst Danz sie zusammen. In seinem schmalen Band formuliert er öfter äußerst dicht und komplex.
Der Berliner Theologe und Barth-Schüler Friedrich-Wilhelm Marquardt (1928–2002) versuchte sich besonders eindrücklich an einer christlichen Neubewertung des Judentums. Jesus eröffne den Völkern einen Zugang zum Bund Gottes. Doch stifte er selbst keinen neuen Bund, sondern „wiederholt vielmehr die Geschichte Gottes mit Israel in seinem eigenen Leben“, so Danz. Jesus hebt also nicht den Bund Gottes mit Israel auf, sondern weitet ihn für die Völker aus.
Auf diese Weise verwurzelt Marquardt das Christentum neu im Judentum. Doch er reduziere so auch die Unterschiede zwischen beiden Religionen. Ja, er vereinnahme das Judentum wieder, so der Vorwurf von Danz. Das Auseinandergehen der Religionen sei dann nur als Missverständnis zu sehen. Mehr noch: Die Besonderheiten der christlichen Religion erschienen als Abfall und Verfall vom Judentum. Und: Je judenfeindlicher christliche Richtungen seien, desto mehr hätten sie sich vom Willen Gottes und ihrer eigenen Bestimmung entfernt.
Dann nimmt Danz Ideen Jürgen Moltmanns (*1926) auf, der das „jüdische Nein zu Jesus als Ausdruck der unerlösten Weltwirklichkeit in der Geschichte“ sehe, „die jedoch selbst bereits eine Vorwegnahme der neuen Schöpfung in Form der Tora voraussetzt.“ Und weiter: „Das jüdische Nein zu Christus ist sowohl Ausdruck des Willen Gottes als auch Kritik an allen innergeschichtlichen Verwirklichungen des Heils.“
Oder trägt die alttestamentliche Messiashoffnung den übergreifenden Bezugspunkt zwischen den beiden Religionen? Der Gesalbte Gottes erscheint danach mitten im unschuldigen Leiden der Welt. Auch so löse sich aber die Einzigartigkeit des Christentums auf, so Danz. Wie aber kann eine Theologie Gestalt gewinnen, die Israel bejaht – und gleichzeitig eine eigene Christologie?
Parallele Entwicklung
Sie entwickelte sich erst allmählich. Gleichzeitig ist es ja nicht so, dass das entstehende Christentum eine bereits fertige Religion des Judentums überwand. Nein, damals gab es eine Vielzahl „judäischer“ Strömungen mit verschiedenen Messias-Vorstellungen. Zu ihnen gehörten auch die Jesus-Anhänger, die zunächst selbst wenig geeint waren.
Nach der Tempelzerstörung im Jahr 70 blieben gerade in beiden Geschwister-Religionen Strömungen erhalten, die starke Standbeine in der Zerstreuung hatten: Paulinisch geprägte Jesus-Anhänger und pharisäisch geprägte Juden. Beide entwickelten sich nun parallel zur heutigen Form in „Anziehungs- und Abstoßungsprozessen“, so Danz.
Sammlung im Judentum
Da lohnt noch mal ein Blick auf das Standardwerk „Die Entstehung der Bibel“ von Konrad Schmid und Jens Schröter (schon in den Ausgaben 9 bis 11/2020 vorgestellt). Nicht nur Jesus-Anhänger verfassten nun Briefe und Evangelien, sondern es entstanden auch weitere jüdische Schriftsammlungen. „Moses und die Propheten“, wie auch in den Evangelien mehrfach zitiert, galten schon unangefochten. Der dritte Teil des Alten Testaments, die „Schriften“ bildete sich erst Ende des 1. Jahrhunderts in der heutigen Form heraus. Er ist bei Flavius Josephus nach der Tempelzerstörung bezeugt: Dazu gehören neben den Psalmen auch Hiob, Sprüche Salomos, Rut, Klagelieder Jeremias, Ester, Daniel, Esra, Nehemia und die Chroniken. Die Makkabäerbücher und Jesus Sirach standen in der Diskussion. Noch im 2. Jahrhundert stritten jüdische Schriftgelehrte darüber, ob etwa Kohelet und Hohelied heilige Texte seien. Um 200 nach Christus sammelte die Mischna mündliche Lehrmeinungen. Der palästinensische Talmud war um 500 beendet, der längere babylonische Talmud noch etwa 300 Jahre später.
Selbst der spätere Märtyrer Ignatius von Antiochien hielt es für notwendig, die Eigenständigkeit des christlichen Glaubens gegenüber dem jüdischen zu betonen. Es schien wohl noch nicht selbstverständlich zu sein. Er starb frühestens 110–117 nach Christus, nach anderer Forschungsmeinung um 138 oder gar erst nach dem Jahr 160. Seine entsprechenden Schriften sollen der Überlieferung nach kurz vor seinem Tod entstanden sein.
Gescheiterter Messias
Dem (heiden-)christlichen Kirchenvater Justin war die Abgrenzung der Christen von jüdischen Gesetzen und Schriften wichtig. Er meinte, dass sie durch Jesu Botschaft neu gedeutet sein müssten. Die Beschneidung sei die Strafe für Verstockung. Er wandte sich an Kaiser Antoninus Pius, der 128–161 regierte.
Da sind wir schon in der Zeit des Bar-Kochba-Aufstandes gegen das Römische Reich 132 bis 136. Darauf weist der Althistoriker Hartmut Leppin in seinem Werk „Die frühen Christen. Von den Anfängen bis Konstantin“ hin. Er analysiert dort auch das Auseinanderwachsen von Juden und Christen im 1. und 2. Jahrhundert aus historischer Sicht.
Nach der Zerstörung des Tempels im Jahr 70, wodurch auch Judenchristen ihren Mittelpunkt verloren hatten, gab es einen erneuten Aufstand gegen Rom. Auf den Anführer Simon richteten sich messianische Erwartungen. Sein aramäischer Beiname „Bar Kochba“ bedeutet „Sohn des Sterns“. Er ist an die messianische Prophezeiung vom „Stern aus Jakob“ (4. Mose 24, 17) angelehnt. Er hatte keine Chance und scheiterte kläglich. Danach war jegliche messianische Hoffnung im Judentum bloßgestellt.
Zurück zu Danz: In diesem Zusammenhang diskutiert er die Menschensohn-Vorstellungen des Danielbuches. Ist das Christentum als eine Stimme in komplexen messianischen Kontroversen zu verstehen?
Die Vorstellung eines jüngeren Gottes neben den Alten tritt im Äthiopischen Henochbuch (Kap. 70 f.) auf. Im Alten Testament findet sich über Henoch nur ein kurzer Absatz in 1. Mose 5: Er ist dort ein Nachkomme Sets und Vater Methusalems. Also nicht wirklich bedeutend. Doch er ist nach späterer Überlieferung wie Elia von Gott in den Himmel entrückt worden. Die äthiopische Kirche überliefert ein Henochbuch. Auch in Qumran fand sich eine weitere Fassung. Einige Richtungen des Judentums dieser Zeit scheinen über ihn als messianische Gestalt neben dem Schöpfergott nachzudenken. Doch ist die genaue Entstehungszeit dieser Ideen nicht datierbar. Das spätere rabbinische Judentum lehnte sie ab.>
Austausch trotz Distanz
Christen waren am Bar-Kochba Aufstand wohl nicht beteiligt – ebenso wenig wie am Ersten Jüdischen Krieg im Jahr 70. Sie hatten aber darunter zu leiden. Nach dem Jahr 135 durften sich Beschnittene nicht mehr in Jerusalem aufhalten. Darunter fielen auch noch Judenchristen.
Schon nach dem Jahr 70 gab es eine Sondersteuer für Juden. Christen, die sich nicht mehr als Juden bezeichneten, konnten da richtig Geld sparen, zeigt Leppin. Von jüdischer Seite aus ließ sich dies aber als Verrat verstehen. Rom duldete christliches Bekenntnis und Kultformen im Unterschied zum Judentum nicht. Doch gewannen nun nichtjüdische Christen an Bedeutung.
Die jüdischen Gemeinden schufen sich eine neue Identität auch ohne Tempelkult: Christen fühlten sich zunehmend ausgeschlossen. Das Jüdische 18-Bitten-Gebet, das nun entstand, enthält eine Bitte gegen die Abtrünnigen. Sind wirklich Christen damit gemeint? Und: „Heute rechnet man mit lokal unterschiedlichen Entwicklungen – ein gemeinsamer Trennungsbeschluss ist angesichts der jüdischen Vielfalt gar nicht denkbar“, meint Leppin.
Trotzdem zeigt er, dass es durchaus noch einen „intellektuellen Austausch“ zwischen Juden und Christen gab: „In dieser Welt der Verwobenheit entstanden Texte, die sich bis heute nicht klar einer dieser Religionen zuordnen lassen“: Jüdische Texte wurden christlich überarbeitet – und auch umgekehrt.
Und noch Euseb von Caesarea (260/64–339/340) kennt „Ebioniten“, die er für „geistig arm“ hält und über die er nach Leppin verächtlich schreibt: „Die Beobachtung der Gesetzesreligion erachteten sie für durchaus notwendig, gerade als ob sie nicht allein durch den Glauben an Christus und auf Grund eines glaubensgemäßen Lebens selig würden. … Sie meinten, man müsse die Briefe des Apostels, von dem sie erklärten, er sei vom Gesetze abgefallen, vollständig verwerfen. Als einziges Evangelium nutzten sie das sogenannte Hebräerevangelium. … Den Sabbat und die sonstigen Bräuche beobachtete diese Richtung gleich den anderen, doch feierte sie auch gleich uns den Tag des Herrn zur Erinnerung an die Auferstehung des Erlösers.“ Die Ebioniten verschwanden jedoch im Dämmerlicht der Geschichte – vielleicht zwischen Juden und Christen aufgerieben.
Doch sie waren nicht die einzigen antiken Christen, die den Apostel – gemeint ist wohl Paulus – geringschätzten. Er gewann erst allmählich an Bedeutung, auch wenn wir es uns heute kaum vorstellen können. Seine Begründung, der Opfertod Jesu habe das jüdische Gesetz hinfällig gemacht, erwies sich für die Loslösung von jüdischen Traditionen als äußerst wirkmächtig. Dies ließ sich antijüdisch wenden, dass Juden verachtenswert seien, weil sie des Gesetzes bedurften.
Andererseits legten Christen zunehmend Wert darauf, sich die Schriften des Alten Testamentes anzueignen und als Verheißungen auf Jesus Christus zu deuten. So auch Justin. In ursprünglicher jüdischer Selbstkritik prangerten etwa die Propheten Missbräuche und Abfall des Volkes an. Sie deuteten die Niederlagen gegen Assyrer und Babylonier als Strafe Gottes. In christlicher Wendung ließ sich das genauso auf die Niederlagen in den Jüdischen Kriegen gegen Rom fortführen – und klang dann äußerst höhnisch.
Noch mehr wollte sich Markion um 140 jüdischer Traditionen entledigen. Er stellte den jüdischen Gott des Zorns dem christlichen Gott der Güte gegenüber. Seine Ideen gingen aber auch vielen christlichen Denkern zu weit. Er galt bald als „Erzketzer“. Doch er stellte erstmals zehn Paulusbriefe und das Lukas-Evangelium, das er radikal auslegte, zusammen. Damit regte er zum Nachdenken an, welche Schriften für Christen nun wichtig sind.
Neuer Umgang mit Ostern
Wie aber entwickelten sich die christologischen Entwürfe im Christentum weiter? Dazu gibt Danz nun auf wenigen Dutzend Seiten eine Einführung in die dogmatische Lehre der Christologie und die Leben-Jesu-Forschung im 19. und 20. Jahrhunderts. Die Forschungen zum historischen Jesus zeigten nach Danz so wenig Resultate, dass sie nicht zu einer „Begründung des Glaubens“ verhelfen konnten. Es bleibe nur die Verkündigung. Doch schon vor dem Osterereignis hätten die Jesus-Anhänger im Kontext der zeitgenössischen jüdischen Religionskultur ihren Herrn verkündet. So ließ sich kaum entscheiden, wann die christliche Religion beginnt und ihre Identitätsbildung einsetzt.
„Dabei fungieren Gott, Christus und der Heilige Geist nicht als gegenständliche Inhalte, sondern diese haben in der christlichen Religion die Funktion, in ihr selbst zu repräsentieren, wie das Christentum als Religion funktioniert und in der Geschichte als religiöse Kommunikation weitergegeben wird“, so Danz.
Uff! Gerade in dem zweiten Teil des Buches wird Danz immer abstrakter: Nach ihm „beschreibt die Christologie den Zusammenhang von gelingender religiöser Kommunikation und deren symbolischer Darstellung in der Religion. Sie ist eine Strukturbeschreibung interner religiöser Symbolproduktion.“
Es gäbe nach Danz eine zunehmende Ausweitung der pluralistischen Christusbilder in modernen theologischen Reflexionen. „Indem die Theologie in der Christologie den Glauben als symbolproduktive Wirklichkeit der christlichen Religion konstruiert, beschreibt sie ihn, den Glauben, als ein Verstehen von religiöser Kommunikation, der sich in einem Bild seiner selbst her- und darstellt. Als eine solche reflexive Symbolverwendung macht die Theologie in der Christologie den Glauben zum Thema ihrer Beschreibung von Religion.“
Ist also der Glaube an Jesus Christus als wahren Mensch und wahren Gott nur eine Vereinbarung innerhalb der christlichen Kommunikation? Ist das nicht ein wenig dünn als Grundlage für den Glauben? Und was ist mit dem unterschiedlichen Verständnis des Nazareners in den verschiedenen Konfessionen?
Diese Fragen scheinen mir wichtig, auch wenn der Ansatz von Danz zu einer konsequenten Neubewertung des Verhältnisses zwischen den Religionen äußerst interessant ist. Doch wirkt er am Ende so abstrakt. Lohnt da doch eine Rückkehr zu Marquardt? Oder hilft ein genauer Blick auf die „Anziehungs- und Abstoßungsprozesse“?
Literatur:
Christian Danz: Jesus von Nazareth zwischen Judentum und Christentum. Eine christologische und religionstheologische Skizze; Mohr Siebeck 2020. 289 S.; 29 Euro; ISBN 978-3-16-159247-8.
Hartmut Leppin: Die frühen Christen. Von den Anfängen bis Konstantin, Verlag C. H. Beck 2019, 512 S., 29,95 Euro, ISBN 978-3-406-72510-4.
Konrad Schmid und Jens Schröter: Die Entstehung der Bibel. Von den ersten Texten zu den heiligen Schriften. Verlag C. H. Beck 2019, 504 S., ISBN 978-3-406-73946-0, 32 Euro.