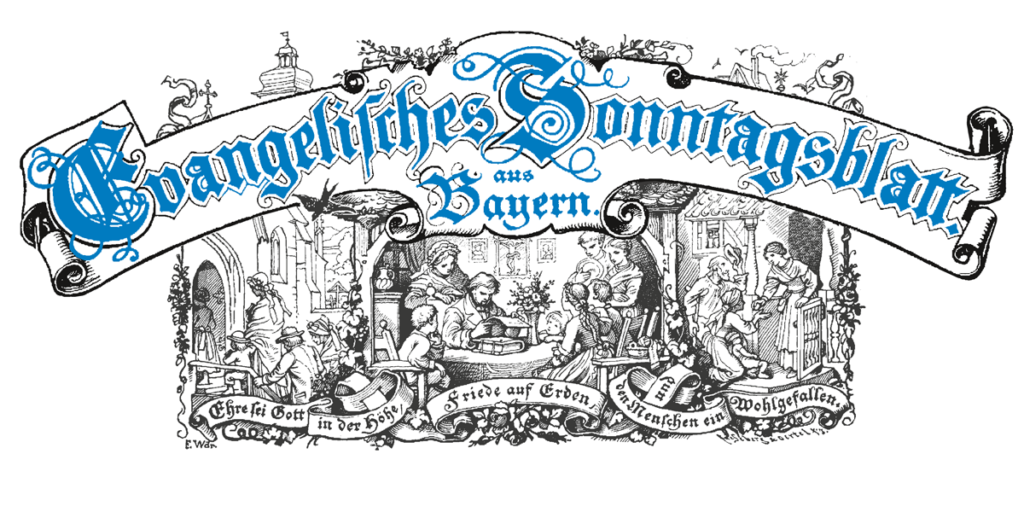Sonntagsblattautorin schreibt Buch über Arbeit als Krankenschwester in der Notfallaufnahme
Inge Wollschläger ist unseren Lesern gut bekannt. Sie arbeitet seit acht Jahren als Journalistin in unserer Redaktion. Sie schreibt Berichte und Kommentare mitten aus dem Leben heraus. Allerdings ist das ihr Nebenberuf. Im Brotberuf arbeitete sie als Krankenschwerster in einer Notaufnahme eines großen Krankenhauses in Würzburg. Letztes Jahr wechselte sie in die evangelische Johannisgemeinde und ist nun für die Seniorenarbeit dort zuständig. Während ihrer Zeit als Krankenschwester hat sie hier im Sonntagsblatt ab und an ihre Erlebnisse aus der Notaufnahme in die Kommentare und Berichte einfließen lassen.
Daraus entstand die Idee einen Blog darüber im Internet zu führen – eine Art Tagebuch, das für die Öffentlichkeit zugänglich ist. Weil dieser so erfolgreich war, ist jetzt ein Buch daraus entstanden. Einerseits ist gerade jetzt in Zeiten der Coronakrise interessant, wie funktionieren die Abläufe in einer Notaufnahme? Wie ticken die Menschen, die in einem Krankenhaus arbeiten? Andererseits ist die Redaktion des Sonntagsblatts natürlich neugierig, was ihre Kollegin geschrieben hat und was sie dazu bewegt hat. Martin Bek-Baier hat sie für die Redaktion befragt.
Um was geht es in dem Buch?
Wollschläger: Es geht um meine Erlebnisse als Krankenschwester in der Notaufnahme, die ich über viele, viele Jahre gesammelt habe.
Und da kommt soviel zusammen, dass man ein Buch schreiben kann?
Da kommt sehr viel mehr zusammen! Da könnte man eine ganze Bibliothek füllen! (Lacht.)
Es geht aber um mehr als nur um medizinische Fälle?
Es gibt tatsächlich Bücher, die schreiben ausschließlich über medizinische Fälle. „Was hatte Patient A? Was haben wir getan? Wie haben wir das Problem gelöst?“ Das sind Geschichten, die mich nicht interessiert haben. Mich haben menschliche Geschichten interessiert.
Welche Geschichten sind das genau?
Ich habe immer beobachtet, wie gehen Menschen mit ihren manigfaltigen Erkrankungen um? Wie verkraften Menschen es, wenn sie schwer verunfallt sind? Was erlebt man, wie sie dann mit ihren Angehörigen umgehen? Solche Geschichten haben mich sehr viel mehr interessiert, als was augenscheinlich ist – er hat sich halt ein Bein gebrochen. Aber das was dahinter steht: Wie kam es dazu? Wie geht man damit um? Das ist das was mich viel mehr interessiert hat.
In dem Buch gehts aber nicht nur um die Patienten.
Es sind natürlich auch Geschichten über den Tagesablauf des Personals in der Notaufnahme, über Kollegen – und vielmehr über Kollegentypen. Man stellt im Lauf der Zeit fest, dass sich Menschen durchaus ähneln, dass man bestimmten Typen immer wieder begegnet: Die heißblütigen Praktikanten. Die schnarchmützigen Ärtzte. Und die Kollegen, die einen in die Pfanne hauen wollen. Und andere großartige Kollegen, die einen fordern und fördern.
Gibt es darüber hinaus auch Informationen für die Leser?
Selbstverständlich geht es auch um das Wesen einer Notaufnahme, wie dort grundsätzlich gearbeitet wird. Wenn man das Buch zuklappt und beiseite legt, sollen die Leser wissen, dass in einer Notaufnahme Menschen arbeiten, die sich jeden Tag darum bemühen, den möglicherweise schlimmsten Tag eines anderen zum Guten zu wenden.
Man liest ja in den Medien oft, wie katastrophal das Gesundheitssystem aufgestellt ist. Das stimmt auch. Aber weltweit gesehen ist es eines der Besten. Die Leser sollen wissen, dass jeder in diesem System auf seine Art und Weise versucht das Beste aus der Situation rauszuholen.
Was wollen Sie denn mit dem Buch erreichen?
Ich möchte die Leser über einen so sensiblen Bereich wie die Notaufnahme aufklären. Es ist nicht alles immer so hochdramatisch, wie es erscheint. Es herrscht in einer Notaufnahmestation auch unheimlich viel Routine – trotz und alledem.
Jeden Tag kommen Leute, die sich das Sprunggelenk verletzt haben. Und jeden Tag kommen Patienten die „Bauchweh“ haben. Und jeden Tag kommen Menschen, die einen Herzinfarkt haben. Das ist für die Betroffenen schlimm, aber für das Personal sind die Fälle ähnlich. Und wir wissen wie man damit umgeht. Ich möchte den Lesern also mitgeben, dass das also kein Bereich ist, vor dem man sich fürchten muss, keiner, indem hinter verschlossenen Türen Geheimnisvolles vor sich geht. Die Leser sollen spüren, dass da Menschen arbeiten, für die es ein Arbeitsplatz ist.
Natürlich möchte ich auch die Absurditäten menschlichen Lebens auch weitergeben, die man jeden Tag auch erlebt. Ein Arzt hat einmal gesagt: „Es gibt jeden Tag einen Dummen, der am Bahnhof aussteigt und es gibt jeden Tag noch einen, der das topt!“
Was wäre denn so ein „Dummer“?
Eines Tages hat sich ein junger Mann mit dem Rettungsdienst einliefern lassen. Ihm täte der Fuß weh. Nach genauerer Nachfrage tat ihm der große Zeh weh, weil er einem Kumpel einen Tritt in den Hintern verpasst hatte. (Lacht!) Viele Menschen haben keine Ahnung mehr von ihrer Körperlichkeit. Sie sind völlig hilflos, wenn es irgendwo einmal weh tut und wissen sich dann bei Kleinigkeiten nicht zu helfen.
Die Notaufnahmen werden mit Bagatellfällen überlaufen. Eine Notaufnahme ist dafür da, dass man dahin kommt, wenn man in Not ist, in richtiger Not.
Man hat weniger Personal, um die Notaufnahmen zu betreiben, wie es notwendig wäre. Und man hat die Bestrebungen der Gesundheitsbehörden Krankenhäuser aufzulösen und Gesundheitszentren zu errichten. Jetzt angesichts von Corona müssen sie feststellen, dass das doch keine superschlaue Idee ist. Man hat in solchen Zentren nicht die Kapazitäten, um so viele Menschen gleichzeitig aufnehmen zu können, wie es bei mehreren kleineren Krankenhäusern der Fall wäre. Vieles in dem Gesundheitssystem ist an der Realität vorbeigelaufen und dient nicht den Menschen.
Im Buch geht es aber trotzdem nicht um die allgemeine medizinische Lage. Mein Eindruck, es geht mehr um Ihre persönlichen Eindrücke?
Ich komme aus einer Familie mit sprachbegabten Eltern. Mein Vater ist ein begnadeter Geschichtenerzähler. Tatsächlich habe ich mir ganz oft überlegt, als ich angefangen habe zu schreiben, „Wie würde ich das meinem Vater erzählen, damit er daran Spaß hätte?“ Wenn ich das Gefühl hatte, es könnte ihm gefallen, dann war es immer ganz leicht.
Natürlich schreibt man so ein Buch auch immer ein bisschen für sich selber. Man betrachtet seinen Lebensweg, wie man milder wird mit der Zeit und aufhört Leute vorzuverurteilen, was man in jungen Jahren tatsächlich schon mal macht. Ich finde es selber befremdlich, wenn Menschen anderen vorschreiben möchten, wie sie zu leben haben. Auf der Notaufnahme habe ich gelernt, dass das nicht angebracht ist. Jeder muss sein Leben auf seine Weise meistern, auf seinen Lebensweg bezogen. Es bringt nichts, anderen reinreden zu wollen. Also die Arbeit auf der Notaufnahme macht sehr viel gelassener!
Sie sind ja eher der muntere und nicht der todernste Typ Mensch.
Was mir sehr geholfen hat und was mir manche Leute sogar auch vorgeworfen haben, ist, dass ich so heiter bin (lacht). Manche Menschen haben sich gewundert. Sie erwarten offensichtlich, dass man sehr ernst sein muss, wenn man in so einem Bereich wie einer Notaufnahme arbeitet. Das stimmt aber nicht. Eine gewisse Grundheiterkeit im Leben schadet selbstverständlich nicht in der Notaufnahme wenn man mit Heiterkeit und Frohsinn, aber auch Gelassenheit und Zuversicht, dem begegnen kann, was wir dort erlebt haben: Nämlich dass Menschen schlimme Schicksale haben, dass sie von langwierigen Krankheiten geplagt sind und dass sie auch sterben.
Es kommen im Buch ja tatsächlich auch ernstere Passagen vor.
Natürlich geht es im Buch auch um Tod und Sterben. Wenngleich wir uns immer bemüht haben, dass es nicht passiert, kommt es selbstverständlich doch vor. Das nimmt einen dann auch schon mit. Gerade im Hinblick auf die Reflexion auf sich selber, wie würde ich das mir für mich wünschen? Ich wollte nicht, dass ich an meinem Lebensende maximal therapiert werden würde. Man kriegt auch mit, dass die Themen Sterben und Tod überhaupt nicht in unserer Gesellschaft vorkommen.
Ich habe es oft erlebt, dass ein Ehepartner von dem anderen über Jahre gepflegt wurde. Nun ist er schwer krank geworden und kommt in die Notaufnahme. Ich fragte dann die Ehepaare, wie es nun im Falle des Sterbens und danach sein solle. Jeder zuckte nur mit den Schultern und sie sagten: „Darüber haben wir nie gesprochen.“ Da frage ich mich schon, wie kann das sein? Das Einzige was im Leben gewiss ist, ist doch der eigene Tod. Wie kann man das nicht ein einziges Mal zur Sprache gebracht haben? Das ist mir unverständlich.
Es gibt wenige Menschen, die Strategien für sich haben, wie sie mit schlimmem Leid umgehen, wenn es sie einmal betrifft. Dazu muss man sich ja auch irgendwann mal im Leben positionieren. Es gibt viele Leute die das verdrängen. Für mich war das zu erleben, ein guter Lehrmeister für mein eigens Leben. Die Geschichten der Patienten, die einen betroffen machen, im positiven, wie im negativen Sinn, bewirken bei einem selbst etwas.
Meiner Ansicht nach, muss man sich selbst immer wieder neu positionieren und neu finden: Wie stehe ich denn im Leben da, wie stehe ich dazu? Das gehört für mich zum professionellen Handeln dazu.
Man spürt diesen Stellen ab, dass Sie mit ihrer ganzen Person Notaufnahmeschwester waren.
Es ist so, dass sich das Wesen einer Person, die in der Notaufnahme arbeitet und die Arbeit sich gegenseitig bedingen. Man muss schon ein bestimmter Typ Mensch sein, um da gerne und gut arbeiten zu können. Ich mag gerne schnelle Abläufe. Ich mag keine Routinearbeiten. Ich mag es gerne im Kopf beweglich zu sein. Wenn Plan A nicht funktioniert, bin ich schon dabei mir Plan B zurecht zulegen. Das Ziel in einer Notaufnahme ist immer klar. Wie es erreicht wird, ist die Freiheit, die ich hatte.
Ein anderer Grund, warum ich in der Notaufnahme gerne gearbeitet habe, ist das breite Spektrum der Arbeit. Eine Notaufnahme ist ein hoch professioneller Bereich, weil man so viel Verschiedenes macht. Man hat auf der einen Seite hochtechnisierte Gerätschaften. Auf der anderen Seite ist ordentliches Handwerk dabei: Wenn man einen guten Gips anlegt, ist das, wie wenn man eine Vase töpfert.
Sie empfanden die Arbeit aber nicht nur als angenehm?
Die Arbeit dort ist natürlich auch ein Höllenstress. Es gab viele Tage, an denen ich nach Hause ging und meine Knöchlein zusammengesucht habe. Sowohl von der körperlichen Seite her, ist es furchtbar anstrengend. Ich hatte einmal einen Schrittzähler dabei. Und obwohl die Notaufnahmen von der Quadratmeteranzahl nicht riesig dimensioniert sind, bin ich an einem normalen Tag zwölf bis fünfzehn Kilometer gelaufen.
Dann kommt andererseits dazu, dass man bis zu zehn Patienten gleichzeitig jonglieren muss. Man muss ständig überlegen, wer kommt wann wohin. Man darf ja eines nicht vergessen, eine Notaufnahme wird vom Pflegepersonal organisiert – nicht von den Ärzten. Wir waren diejenigen, die die Leute zunächst angeschaut haben. Wie krank sind die? Wie schnell müssen sie behandelt werden? Wir sind diejenigen, die die Patienten und die Ärzte auf die Zimmer, auf die Räumlichkeiten verteilt haben. Mit so vielen Bällen gleichzeitig umzugehen und allen Patienten gerecht zu werden, das ist schon sehr, sehr anstrengend.
War das der Grund, warum Sie diese Arbeit vergangenes Jahr aufgehört haben?
Naja, der Grund war, um es mit einem Zitat aus dem Film „Der Schuh des Manitus“ zu sagen: Ich war mit der Gesamtsituation ncht mehr zufrieden. Prinzipiell ist die Arbeit in einer Notaufnahme toll. Ich wüsste nicht, wo ich in all meinen 30 Berufsjahren lieber gewesen wäre als da. Aber irgendwann nach knapp 21 Jahre in der Notaufnahme kam der Punkt, an dem ich dachte, jetzt ist es gut, wenn ich gehe. Die Belastung ist über die Jahre immer mehr geworden. Es gab auch immer mehr Restriktionen. Ich hatte zum Schluss 34 unterschiedliche Schichten.
Dazu kommt, dass es einen richtigen Exodus in dieser Notaufnahme gab. Sehr viele Kolleginnen und Kollegen haben gekündigt. Und heute knapp zwei Jahre danach ist diese komplette Notaufnahme von rechts nach links gewendet. Es gibt höchstens noch eine Handvoll Kollegen, die ich kenne, die dort arbeiten. Alle anderen sind neu. Das ist schon ein Wort, bei einem Team, das fast zwanzig Jahre stabil war. Den Erfolg einer Notaufnahme macht ein gutes Team aus, das gut zusammenarbeiten kann.