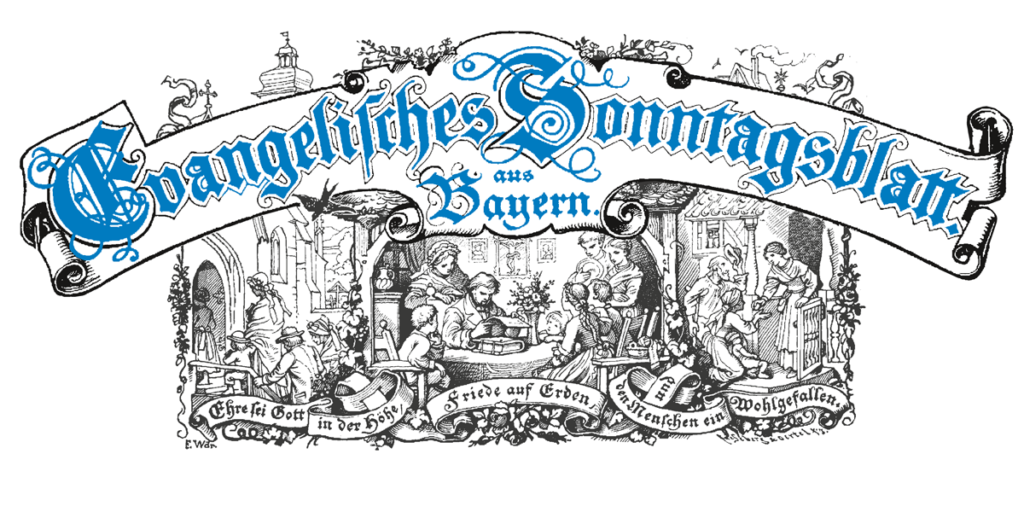Ganz persönliche Erinnerungen von Martin Bek-Baier
Als ich am 3. Oktober 1990 – dem ersten Tag der Deutschen Einheit – mit meiner Verwandtschaft in Oberfranken zusammen saß, war die Freude über den Mauerfall und die gewonnene Einheit bereits ein bisschen getrübt. Überall Ossis: Die Parkplätze voll mit Trabis, in den Geschäften zu viele Menschen, hieß es da bei gebrühtem Kaffee und Streuselkuchen. Die seien vorlaut und fordernd. Mein Onkel und mein Vetter waren sich einig: Die Einheit habe auch eindeutige Nachteile für die Region um Hof gebracht.
Was war das noch für eine Begeisterung und eine Freude etwa elf Monate zuvor! „Du kannst dir das nicht vorstellen Martin: Die ganze Autobahn voller Trabis, die Straßen nach Hof ein einziger Stau mit unseren deutschen Geschwistern aus dem Osten“, hieß es da. Welch Freude kam auf! Man überreichte Blumen am Straßenrand oder warf sie von der Autobahnbrücke.
Damals, Anfang 1990, fragte mich dann mein Onkel: „Und wie hast du denn den Tag des Mauerfalls erlebt, Martin?“ Ich studierte damals in Wien. Und ehrlich gesagt, am 9. November 1989 hatte ich gar nichts vom Mauerfall mitgebekommen. Erst als ich einen Tag später am Nachmittag im Seminar der Evangelischen Fakultät saß, wunderte ich mich über das aufgeregte Getuschel der Kommilitoninnen. Bis es auch zu mir vordrang: „Die Mauer ist gefallen!“ Na sowas! Und ich hatte es förmlich verschlafen.
Dabei hatte die Aufregung in Österreich über die politischen Lockerungen und die massiven Veränderungen im Osten schon viel früher begonnen. Die ersten waren die Ungarn, die den eisernen Vorhang beiseite schoben. Monatelang war ein gängiges Zahlungsmittel auf der Mariahilfer Straße, der Einkaufsmeile der österreichischen Metropole, die „echte ungarische Salami“. Sie wurde so hoch gehandelt, dass es sich sogar lohnte sie zu fälschen. Kein Falschgeld, sondern unechte „echte“ ungarische Salamis verwässerten die Freude der österreichischen Geschäftswelt an dem neuen osteuropäischen Kundenkreis.
Als dann im Laufe des Herbstes 1989 ganze Busflotten Tschechen und Slowaken in die Donaumetropole strömten, shoppten die Ungarn längst im Anzug mit Sonnenbrille und Goldkette auf der Mariahilfer Straße. Die in alten Jeans und 80er-Jahre-Daunenanorak gekleideten Tschechen, konnten dagegen nur mit großen Augen und platten Nasen in die Schaufenster der Luxusläden blicken, in denen nun Schilder hingen mit der Aufschrift „Keine Salami als Zahlungsmittel!“
Als im November 1989 dann auch noch DDR-Bürger nach Österreich kamen und an den Bankschaltern nach dem Begrüßungsgeld fragten – kein Witz, das kam tatsächlich öfter vor – da war es spätestens aus mit der österreichischen Gemütlichkeit.
Ich gestehe, ich bin ein typischer Wessi. Darunter verstehe ich, dass mein Leben bis 1989 ziemlich ohne die DDR und deren Menschen auskam. Ein Jahr vor meiner Geburt wurde die Mauer hochgezogen. Wir hatten keinerlei Verwandtschaft im „Osten“, wie man damals so sagte. Die DDR war bis zu meinem 16.
Lebensjahr für mich unbekanntes Ausland – aber sowas von. Das schlimmste Ausland überhaupt, denn an keiner Grenze ging es so menschenunwürdig zu, wie an der zur DDR, wenn man mal nach Berlin fahren wollte. Das kam selten genug vor, weil wir dort auch keine Verwandten – und auch keinen Koffer – hatten.
Mit 16 Jahren nahm ich an einer Jugendbegegnung der Evangelischen Jugend Traunstein mit DDR-Bürgern aus der Gegend von Chemnitz teil. Da wurde viel politisiert und über die Verhältnisse debattiert. Eines wurde mir klar: Die DDR war ein anderes Land, in denen man zwar so was ähnliches wie Deutsch sprach, wo es aber zu wenig Kaffee, Bananen und Ananas zu kaufen gab. Ich schickte fortan Weihnachtspakete mit Kaffee, getrockneten Bananenchips und Ananasdosen; aber, es blieb bei meinem Eindruck: Das sind zwei verschiedene Länder und da-ran wird sich nichts ändern.
Als 1989 die Mauer fiel, fand ich das interessant, aber da ich kaum Bezug zu diesem Land hatte, schütteten sich auch nicht übermäßig viele Endorphine aus. Aber eines war deutlich anders: Wir hatten plötzlich doch ganz viele Verwandte und ich hatte auf einen Schlag ein halbes dutzend Cousinen gewonnen, die Mandy und Sandy und ähnlich hießen. Guck an! Das fand ich sehr verwunderlich. Denn vor dem Fall der Mauer hatte mir niemand davon erzählt.
Inzwischen war ich in den vergangenen 30 Jahren schon oft im Osten – pardon – den neuen Bundesländern. Nicht zuletzt auch als Journalist für das Sonntagsblatt. Ein bisschen exotisch war und ist es immer noch, dort Orte und Landschaften samt ihren Menschen zu entdecken. Aber vorwiegend empfinde ich das als sehr positiv. Mit Wien dagegen verbindet mich jedoch zurzeit nur noch wenig.
Ich nehme heute mit Sorge wahr, dass sich viele Menschen in den neuen Bundesländern abgehängt fühlen und wirtschaftlich schlechter gestellt sind, als Menschen in vergleichbaren Berufen und Lebensverhältnissen im Westen. Das ist sicher ein Grund dafür, dass dort der Rechtsextremismus und die Fremdenfeindlichkeit prozentual stärker vertreten sind, als im Westen. Dass gerade dort Rattenfänger der rechten Szene und die AfD erstarken, macht mir Angst.
Ich habe jedoch viele Bekannte und Freunde in den neuen Bundesländern, bei denen diese Gefühle und Gesinnungen nicht vorherrschen. Sie sind Bundesbürger mit einem Auf und Ab im Leben, mit einem Alltagsleben und Schicksalen, wie es überall in Deutschland wohl als normal gelten kann. Man könnte naiv sagen: „Die sind ja genau wie wir!“
Zu den Erinnerungen