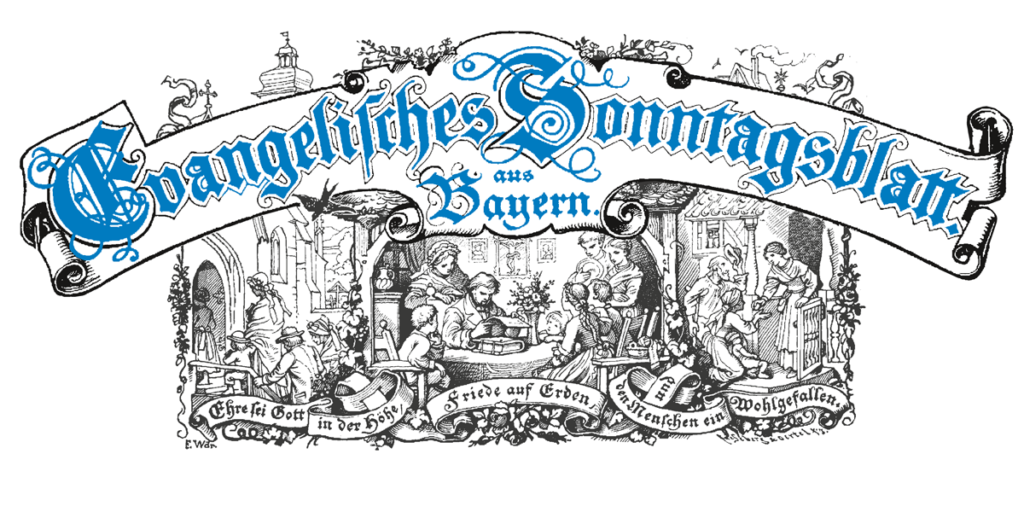Nürnberger Kunstvilla denkt in „Grauzonen“ über Verantwortung von Künstlern nach
Um Anerkennung kämpfte sie mit allen Mitteln: Irma Goecke (1895–1976) lebte für die Kunst. Als Frau und wegen ihrer teils französisch-belgischen Herkunft hatte sie es nach 1918 und besonders nach 1933 doppelt schwer Fuß zu fassen. Irma Goecke wich in die Textilkunst aus (Bild oben). Sie sprengte als aktive Künstlerin das Frauenbild der Nazis. Dabei war sie von 1941 bis 1966 künstlerische Leiterin der Nürnberger Gobelin-Manufaktur.
Bis 1945 produzierte sie Webteppiche und Gobelins für das Reichsparteitagsgelände oder für SS-Unterkünfte. Berüchtigt war ihre germanische Weltesche für eine SS-Kaserne, die jedoch im Original verschollen ist. Nach 1945 wurde sie kurzzeitig ihres Amtes enthoben, bei der Entnazifizierung dann als „Mitläuferin“ eingestuft. Sie stellte weiter aus – 1955 sogar in den USA. 1960 erhielt Goecke in München den Bayerischen Verdienstorden.
Handelten Irma Goecke und ihre Weggefährten verantwortungslos? Viele von ihnen hatten davon profitiert, dass für Förderung und Ankauf ihrer Werke Platz frei geworden war. Jüdische oder auch politisch missliebige Kunstschaffende waren schnell davon ausgeschlossen, bevor sie weiter verfolgt wurden. Die Nazis förderten gezielt Künstler mit richtiger Herkunft und Gesinnung.
Die „Kunstvilla“ besitzt ein ganzes Depot schwieriger Kunstwerke. Rund ein Viertel ihrer 1.500 Werke von Nürnberger Kunstschaffenden stammt aus der Nazi-Zeit oder kurz davor – jedoch schon im strammen Gleichschritt. Viele dieser Werke des 2014 gegründeten Museums verschönerten bis in die 1970er-Jahre hinein Verwaltungsgebäude der Stadt oder waren im Depot. Die Schau „Grauzonen“ stellt sie aus.
Dazu gehörte es, in der Reichskulturkammer organisiert zu sein. Durch die Gleichschaltung bisheriger Kunstvereinigungen fanden sich auch Kunstschaffende „passiv“ dort wieder. „Es gab auch Künstler wie Georg Hetzelein, die sich in eine ‚innere Emigration‘ zurückzogen“, meint Kunstvilla-Leiterin Andrea Dippel. Sie konnten nicht mehr ausstellen oder verkaufen. Wer nicht stumm bleiben wollte, hatte Auftragswerke anzunehmen oder industrielle Erfolge zu feiern – was auch nach 1945 gut lief.
Was tun mit dieser Kunst?
„Grauzonen“ also überall, obwohl es damals keine Kunstschaffenden erster Güte der Avantgarde in Nürnberg gab, so Dippel. Die Nationalsozialisten sahen das anders. Auf der Liste der „Gottbegnadeten“ befanden sich etwa die Nürnberger Kunstdozenten Hermann Gradl und Max Körner. Sie brauchten nicht an die Front. Auch Künstler in Uniform waren keineswegs benachteiligt. Oft konnten sie an der Front weiter malen – sogar in Kriegsgefangenschaft.
Wozu braucht es aber heute noch diese Kunst? Etwa das „Selbstbildnis mit Stahlhelm“ von Heinrich Göttler (1890–1969)? Es entstand bereits 1929. Erscheint der Soldat von Jesus gesegnet und behütet? Oder durch das Leiden irritiert? Obwohl seine Gesichtszüge feist sind, ist der Blick nachdenklich, aber stramm nach vorne gerichtet. Der Pinsel fast anmaßend parallel zum Arm des Gekreuzigten – ansonsten keine Reaktion auf Jesus. Inszeniert sich Göttler „als gläubigen Soldaten und Maler in der Nachfolge Christi“, wie es im entstehenden Ausstellungskatalog heißt – oder sprengt er das? Das Werk scheint exakt auf dem Kipppunkt zwischen beiden Polen zu liegen.
Heinrich Göttler war bereits 1931 der NSDAP und 1933 der SA-Reserve beigetreten. Das Selbstbildnis erschien prominent in seiner Autobiografie 1933 – Hitler gewidmet, aber auf dem Index zur „Bücherverbrennung“, da es offenbar zu realistisch die Schrecken des Ersten Weltkriegs beschrieb. Göttler malte weiter Stadtansichten, aber auch patriotische Werke zum „Luftkampf“ und für die „Hitlerjugend“, dann wieder Trümmerbilder. Nach 1945 verstummte er fast ganz. Ambivalent?
Da ist der „Bauer“ im blauen Hemd von Andreas Bach (1886–1963) vergleichsweise wenig herausfordernd – auch wenn Kunstschaffende damals gerne die heile Welt der Bauern darstellten. Doch seine Landschaftsgemälde in fast schon impressionistischer Farbgebung wirken schwungvoll leicht.
Halt! Andrea Dippel erklärt gerade, dass Bach im Hauptberuf im Wehrkreiskommando aktiv war. Zwar gerieten die Landschaftsbilder nach 1933 schon mal auf den Index, aber mit seinen Verbindungen wandte sich Bach durchaus fordernd – und erfolgreich dagegen. Zunehmend waren seine Werke wieder gefragt – auch nach 1945 malte er entsprechend weiter. Er verkaufte bis 1955 regelmäßig an die Stadt.
Sie blieben genauso in öffentlichen Gebäuden präsent wie die anderen Werke. Die Künstler waren meist nur als Mitläufer eingestuft, sie konnten weitermalen. Für viele ehemals verfolgte Künstler war es dagegen schwierig, wieder Fuß zu fassen, zumal sie oft traumatisiert waren. Sinnvoll ist die Auseinandersetzung mit dieser Zeit, ihren Folgen und Doppeldeutigkeiten – gerade um bei den schönsten Landschaftsbildern nicht zu vergessen, dass diese Produktion zu Lasten der Verfolgten ging. Susanne Borée
Schau bis 6. November in der Kunstvilla, Blumenstraße 17, dienstags bis sonntags 11–18 Uhr, mittwochs bis 20 Uhr. Mehr: https://www.kunstkulturquartier.de, Tel. 0911/231-15893. Wohl im August erscheint der Katalog.