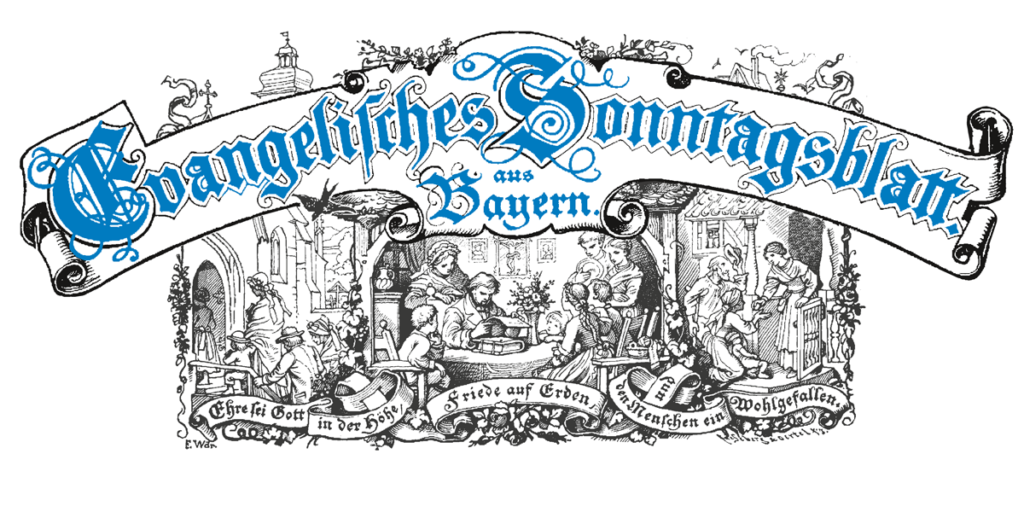Ausstellung zu 1.700 Jahren deutsch-jüdischer Geschichte mit irritierenden Brechungen
Eine Madonna, die um Jesus trauert – in einer Ausstellung über „1.700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte“? Was auf den ersten Blick irritiert, erschließt sich schließlich durch doppelte Brechung „Im Labyrinth der Zeiten“ und führt zu erstaunlichen Aha-Erlebnissen.
Das jüdische Museum München begibt sich damit auf die Spuren Mordechai Wolf Bernsteins (1905–1966). Zwischen 1948 und 1951 begab er sich im Auftrag des „Jüdischen Wissenschaftlichen Instituts“ (YIVO) auf eine Irrfahrt zu rund 800 Orten quer durch Deutschland – auf der Suche nach Überresten von Spuren jüdischer Kultur in Deutschland. Da kam er auch noch Rothenburg.
Die Pietà aus dem 14. Jahrhundert aber fand er in der ehemaligen Schnaittacher Synagoge östlich von Fürth. Das Gotteshaus ging in der Pogromnacht 1938 nicht in Flammen auf: Und zwar deshalb, weil der Hafnermeister und ehrenamtliche Leiter des örtlichen Heimatmuseums Gottfried Stammler es unbedingt als Erweiterung für seine beengten Räumlichkeiten haben wollte. Er bekam die Synagoge nun zu einem Spottpreis. Umgehend behauptete er, dass sie eine Kirche gewesen sei und stellte gerade christliche Kirchenkunst dort aus.
Erschütterung über „Umwidmung“
„Erschüttert von Scham und Schmerz wandte ich den Blick von der Ostwand dieses Schnaittacher Schreins ab“, so Bernstein, als er in der Nachkriegszeit vor Ort war, „nicht nur wegen der religiösen Profanität, sondern auch wegen des blutigen Witzes“: Die Pietà hatte Stammler ausgerechnet in die ehemalige Thora-Nische gestellt – so wie es öfter zu ihrer Entstehungszeit geschah, wenn Synagogen bei Pogromen enteignet und oft zu Marienkirchen umgewidmet wurden.
Noch 1953 versuchte Stammler durch Grabungen zu beweisen, dass die Fachwerk-Synagoge ehemals eine Kirche gewesen sei. Wenig überraschend, dass sich nie archäologische Belege fanden – höchstens bei umgekehrten Fällen. Nun gehört sie zum Jüdischen Museum Franken.
Weitere 17 Objekte, die Mordechai W. Bernstein nach 1948 aufspürte, zeigt die Münchner Schau in ihren abgedunkelten Räumen voller Sackgasen. Öfter sind scheinbare Durchgänge plötzlich von Spiegeln blockiert oder führen ins Nichts.
Schilderungen über Begegnungen
Die tiefere Bedeutung vieler Objekte und ihrer Geschichten zeigt sich besonders durch die umfangreichen Erläuterungen und die Reportagen Mordechai W. Bernsteins im Katalog. Sie bieten äußerst lebendige Einblicke in seine Irrfahrten. Ursprünglich erschienen sie auf Jiddisch – und waren bald vergessen. Das Jüdische Museum hat sie wieder entdeckt und eine Auswahl übersetzt. Sie schildern mit feinem Kopfschütteln öfter absurde Situationen und Verstecke. So bieten Bernsteins Schilderungen nicht nur vielfältige neue Erkenntnisse, sondern sind trotz ihrer geschilderten Absurditäten unterhaltsam zu lesen.
Der Journalist und Historiker erblickte 1905 im heutigen Belarus das Licht der Welt. Den Kriegsausbruch 1939 erlebte Bernstein im litauischen Wilna, als die Sowjetunion nach dem Hitler-Stalin-Pakt dort einmarschierte. Im August 1940 inhaftierte ihn dort die sowjetische Geheimpolizei. Bis gegen Kriegsende blieb er mit Unterbrechungen inhaftiert, wobei es ihn ins heutige Usbekistan verschlug. Im Sommer 1946 gelangte Bernstein nach Polen und kam 1948 in Feldafing in einem Lager für „Displaced Persons“, also heimatlose Juden, an. Dort erhielt er den Auftrag für seine Entdeckungsfahrten, bevor ihm Anfang 1952 die Ausreise nach Argentinien gelang. 1966 starb er. Schon dies zeigt, in welchen Labyrinthen er sich persönlich bewegte.
Der Flüchtling beim Fürsten
Einen Gegenpol zu Gottfried Stammler bildeten die Fürsten Leiningen in Amorbach. In diesem Mini-Fürstentum an den äußersten Grenzen Unterfrankens tauchte Bernstein tief ins Hofarchiv und ins Familienmuseum ein. Dort fand er in der Ahnengalerie einen uralten handgemalten Midrasch – um die Gebetsrichtung nach Jerusalem zu kennzeichnen. Wie Bernstein erfuhr, wurde dieser Midrasch „dem Fürsten vor ungefähr hundert Jahren“ – um 1850 – „als Geschenk von einem seiner Schutzjuden“ überreicht. 1934 gab es strengen Befehl, diesen Midrasch zu vernichten
Der fürstliche Familienrat versteckte dies unter einem Ahnenporträt und dokumentierte dies in einem geheimen Familienprotokoll mit der Aufschrift, „dass nur nach dem Tod des Familienältesten sein Nachfolger es öffnen“ durfte. Doch dieser Vorsichtsmaßnahme bedurfte es nicht: Im August 1945 konnte es wieder seinen Platz einnehmen
Und Bernstein begegnete einem uralten Mitglied der Fürstenfamilie, einem Veteran des 1870-er Krieges: „zwei erloschene Augen eingerahmt von knöchernen und vertrockneten Wangen und Schläfen, ein dünnhäutiges Gesicht, das von einem absurd langen Backenbart eingefasst war“ empfing ihn. Und seine „jüngferliche Tochter, die achtzigjährige Mathilde erzählte mir“: Auch ihr Vater habe 1870 in Straßburg ein jüdisches Mädchen gehabt, dessen Vater „mit der Breindl des Hoffaktors Isaak angebändelt“ und so fort. – Da ahnte Bernstein schon, warum der Midrasch in der Ahnengalerie hing.
Der Midrasch ist nun genauso in München zu sehen wie zwei Gunzenhäuser Thoraschilder aus dem 17. Jahrhundert. Es sind fein ziselierte Metallschilder, die mit Ketten an die Thorarollen gehängt werden und mit austauschbaren Schildern Feiertage benennen. 1945 waren sie verschollen. Bernstein wurde nun auf die Suche nach ihnen geschickt. Er meinte sie in einem Nebenraum der Ansbacher Synagoge voller Gerümpel gefunden zu haben, doch war dort ein ähnliches Exemplar aus Mönchsroth.
Später stellte sich heraus: Sie gehörten einem Sigmund Dottenheimer, dessen Nachfahren unter dem Namen Dottheim in New York leben. Sie verwahrten das Familienerbe bei der Bat Mizwa der Tochter Kara, bevor es nun als ständige Leihgabe an das Haus der Bayerischen Geschichte in Regensburg ging.
So stellt der Katalog Bernsteins Perspektiven aus der Nachkriegszeit dem heutigen Forschungsstand gegenüber. Und zeigt, dass für viele Objekte verschlungene Wege in den vergangenen gut 70 Jahren weiter gingen – sie aber auch zu ihren Wurzeln zurückfanden.
„Im Labyrinth der Zeiten. Mit Mordechai W. Bernstein durch 1.700 Jahre deutsch-jüdische Geschichte“ bis 13. Februar 2022 im Jüdischen Museum München. Geöffnet Di–So von 10 bis 18 Uhr. Mehr Infos unter https://juedisches-museum-muenchen.de oder Tel. 089/23396096. Der gleichnamige Katalog von Bernhard Purin und Ayleen Winkler (Hg.), 29,80 Euro, 342 S., ISBN 978-3-95565-431-3 ist auch unbedingt unabhängig vom Ausstellungsbesuch empfehlenswert.